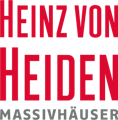KfW 40 Massivhaus: Energieeffizient bauen

Klimafreundlich, ressourcenschonend und nachhaltig – Energiesparhäuser mit bestmöglichen Energiestandards gewinnen zurecht zunehmend an Bedeutung. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie Sie Ihr KfW 40 Massivhaus möglichst energieeffizient und zukunftsorientiert gestalten können. Maßgeschneiderte Wärmedämmung, Wärmepumpen und Photovoltaik- sowie Solaranlagen stellen nur einige der Wege dar, regenerative Energien effizient zu nutzen, die sich für Sie in bares Geld umwandeln.
Denn nicht nur sparen Sie so Energie und Verbrauchskosten, Sie können gleichzeitig für ein Massivhaus mit KfW 40 Standard verschiedene Förderungen beantragen. Die höheren Investitionskosten für ein KfW 40 Massivhaus zahlen sich demnach langfristig in jeder Hinsicht aus – ein positiver Beitrag für den Klimaschutz inklusive.
Vergleichen Sie hier moderne Massivhäuser im KfW 40 Standard und bauen Sie ein Zuhause für eine nachhaltige Zukunft. Außerdem erfahren Sie hier, welche weiteren Maßnahmen bei der Umsetzung Ihres KfW 40 Massivhauses zum Tragen kommen, wie der Wandaufbau idealerweise aussieht, welche Steine sich am besten eignen und welche Kosten bei einem Massivhaus mit KfW 40 Energiestandard zu erwarten sind.

Massivhäuser mit KfW 40 Energieeffizienz-Standard entdecken

Kostenlos Kataloge & Informationen anfordern!
Seien Sie bestens informiert bei Ihrer Traumhauswahl! Fordern Sie Informationen von Baupartnern in Ihrer Nähe an, um bei der Entscheidung gut vorbereitet zu sein.
Kataloge anfordernWas ist ein KfW 40 Massivhaus?
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, definiert verschiedene Effizienzhaus-Stufen im Vergleich zu einem im Gebäudeenergiegesetz (GEG) standardisierten Referenzgebäude. Bei der Einordnung in diese Energiestandards werden zwei Nenngrößen herangezogen, nämlich der Primärenergiebedarf für Strom und Wärme sowie der Transmissionswärmeverlust, also wie viel Wärmeenergie aus dem beheizten Gebäude ungewollt in die Umgebung abgegeben wird.
Ein Fertig- oder Massivhaus als KfW 40 Effizienzhaus verbraucht lediglich 40 % der Primärenergie dieses Vergleichsobjekts und ist so gut gedämmt, dass es höchstes 55 % des entsprechenden Wärmeverlusts aufweist.
Auch die Massivbauweise mit modernen Baustoffen, mehr dazu im Folgenden, eignet sich für besondere Nachhaltigkeit und Energieeffizienz beim Bau mit einer ausgeglichenen Ökobilanz und optimalen Input-Output-Verhältnis beim Energieeinsatz. Erreicht wird beim Massivhaus der KfW 40 Standard neben einer energieeffizienten Heizung mit erneuerbaren Energien (beispielsweise Geo-, PV- oder Solaranlage in Kombination mit Wärmepumpe) durch hervorragende Wärmedämmung des gesamten Bauwerks von Dach über Außenwände bis hin zur Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren, dreifachverglaste Wärmeschutzfenster mit inbegriffen. Auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und -tauscher ist sinnvoll.
Massivhaus KfW 40: Kosten & Preise

Die effektivere Dämmung und umfassende Haustechnik zur Nutzung regenerativer Energien begründen bei einem KfW 40 Massivhaus die vergleichsweise etwas höheren Baukosten als bei KfW 55 Standard – bringen aber gleichzeitig dauerhafte Spareffekte bei Energie- und Verbrauchskosten mit sich.
Neben der konkreten technische Ausstattung und angewandten Dämmtechnik sind es vor allem die generelle Ausführungsqualität, regionale Preisunterschiede beim Handwerk, die gesamte Wohnfläche und die jeweilige Ausbaustufe, die beim KfW 40 Massivhaus Preise und Kosten beeinflussen. Im Gegensatz hierzu fällt die Bauweise nicht ins Gewicht, ein KfW 40 Massivhaus kommt auf den gleichen Hauspreis wie ein gleichwertiges Fertighaus.
Als Richtwert dienen durchschnittliche Preise pro Quadratmeter von 2.700 Euro ab Oberkante Bodenplatte für ein Massivhaus mit KfW 40 Energieeffizienzstufe. Zusätzlich einzukalkulieren sind Baunebenkosten, Grundstückskosten, Aufwendungen für die Außenanlage (zum Beispiel Garage, Carport, Garten, Regenwasser-Zisterne, Brunnen), Bodenplatte und gegebenenfalls die Unterkellerung, wie auch ein Puffer für sonstige Ausgaben, etwa für Richtfest und Umzug.
Massivhaus KfW 40: Kosten schlüsselfertig
KfW 40 Massivhaus: Preis als Ausbauhaus
Massivhaus KfW 40 Massivhaus: Preise für Bausätze
KfW 40 Massivhaus: Steine & Baumaterialien
Auch ein KfW 40 Massivhaus wird typischerweise noch klassisch Stein auf Stein gebaut. Aber Stein ist nicht gleich Stein. Die verwendeten Stein- oder Ziegelarten besitzen bezüglich Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sehr unterschiedliche Qualitäten. Die gängigsten Steine sind Ziegel, (Normal-)Betonsteine, Kalksandstein und Porenbetonsteine.
KfW 40 Massivhaus: Wandaufbau
Für ein KfW 40 Massivhaus kommt beim Wandaufbau vorwiegend Leichtmauerwerk zum Einsatz, wozu Porenbetonsteine, Leichtbetonsteine und Leichtlochziegel zweckdienlich sind. Wird ein schweres Mauerwerk, wie beispielsweise Beton gewählt, so ist eine mehrschalige Wand notwendig. Das hat zur Folge, dass die Wanddicke erheblich zunimmt, wodurch die Wohnfläche sich verkleinert.
Einschaliger Wandaufbau:
- Leichtmauerwerk mit Außenputz (z.B. Leichthochlochziegel, Porenbeton- oder Leichtbetonstein)
- Leichtmauerwerk mit Wärmedämmputz
- Leichtmauerwerk mit WDVS
- schweres Mauerwerk mit Wärmedämmung und Vorsatzschale
Zweischaliger Wandaufbau:
- unterschiedlich schweres Mauerwerk mit Wärmedämmung (inkl. Luftschicht oder Kerndämmung)
Dach:
- Massivdach aus Ziegel, Poren- oder Leichtbeton, ggf. mit zusätzlicher Wärmedämmung
Energieeffizientes Massivhaus: Geeigneter Wandaufbau für ein Passivhaus
Die Anforderungen an den Wandaufbau eines Massivhauses im Passivhaus-Standard setzen einen noch höheren Wärmeschutz sowie eine hohe Luftdichtheit der Gebäudehülle voraus. Am besten eignen sich Kalksandstein und Porenbetonstein für den Bau eines massiven Passivhauses.
Einschaliger Wandaufbau:
- Mauerwerk aus Kalksandstein mit WDVS (mind. 17,5 cm)
Geeignete Dämmstoffe: Polyurethan, Polystyrol-Partikelschaum, Mineralschaum, künstliche Mineralfasern und einige biogene Dämmmaterialien - Mauerwerk aus Porenbeton (mind. 48 - 50 cm) mit Innenputz (0,8 cm) und Außenputz (1,5 cm)
- Mauerwerk aus Porenbeton (36,5 cm) mit Innenputz (0,8 cm) und Außenputz (1 cm) sowie WDVS (ca. 10 cm)
Zweischaliger Wandaufbau:
- Innenschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) mit Wärmedämmung (mind. 16 cm) und Luftschicht (mind. 4 cm) sowie frostwiderstandsfähigem Verblendmauerwerk (mind. 11,5 cm)
- Innenschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) mit Kerndämmung (mind. 20 cm) sowie frostwiderstandsfähigem Verblendmauerwerk (mind. 11,5 cm)
- Mauerwerk aus Porenbeton (mind. 24 cm) mit Kerndämmung (mind. 14 cm), Innenputz (0,8 cm) und frostwiderstandsfähigem Verblendmauerwerk (mind. 11,5 cm)
Förderungen für ein KfW 40 Massivhaus
Wollen Sie ein KfW 40 Massivhaus bauen, vergibt die KfW zinsgünstige Darlehen im Rahmen der Programme Klimafreundlicher Neubau und Wohneigentum für Familien. Diese zinsverbilligten Kredite lassen sich mit zusätzlichen Fördermitteln ergänzen. So etwa lässt sich bei allen Bauvorhaben das KfW-Wohneigentumsprogramm zur Finanzierung von beispielsweise Grundstück und Grundstücksnebenkosten wie Notar und Grunderwerbsteuer, oder für eine Photovoltaik-Anlage gesondert der Kredit Erneuerbare Energien – Standard beantragen.
Doch wie hoch ist die Förderung bei einem neu errichteten KfW 40 Massivhaus? Das Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau beläuft sich auf maximal 150.000 Euro, Wohneigentum für Familien auf maximal 270.000 Euro.
Anbieter fürs Massivhaus mit KfW 40 Standard
KfW 40 Massivhaus: Häufige Fragen